Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
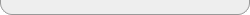
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Ein Leben ohne Kinder â Kinderlosigkeit in Deutschland
| ISBN | 3531149334 | |
| Autoren | Dirk Konietzka , Michaela Kreyenfeld | |
| Verlag | Vs Verlag für Sozialwissenschaften | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 432 | |
| Erscheinungsjahr | 2007 | |
| Extras | broschierte Ausgabe |

Rezension von
Christoph Kramer
Die Herausgeber dieses Sammelbandes wollen sich mit ihrer âsoziologischen Bestandsaufnahmeâ zur Kinderlosigkeit in Deutschland von âInhalt und Duktusâ der medialen Berichterstattung zum Thema abheben (wobei offenbar vor allem an die Berichterstattung zu den â40 Prozentâ kinderlosen Akademikerinnen gedacht ist). In der Einleitung (und auch in mehreren BeitrĂ€gen) finden sich kritische Reflektionen ĂŒber die verfĂŒgbaren Daten zur Kinderlosigkeit, besonders zu den Erhebungsverfahren. TatsĂ€chlich sind alle, die sich an der öffentlichen Debatte beteiligen, diesbezĂŒglich auf SchĂ€tzungen und NĂ€herungswerte angewiesen. Dies liegt vor allem an der âkatholischen Statistikâ (Bernd Kittlaus) in Deutschland, die nur Geburten nach der Rangfolge eines bestehenden Haushalts (Mikrozensus) bzw. innerhalb einer bestehenden Ehe (Bevölkerungsstatistik) erfaĂt, und nicht â wie in den meisten anderen LĂ€ndern â nach der biologischen Rangfolge. WĂ€hrend also der absolute RĂŒckgang der Kinderzahlen unstreitig ist, lĂ€Ăt sich die Frage, in welchem AusmaĂ Kinderlosigkeit bei einzelnen Bevölkerungsgruppen (etwa die vielbeschworenen Akademikerinnen) daran beteiligt ist, nur unter bestimmten Vorbehalten beantworten. Die BeitrĂ€ge des Bandes sind in vier gröĂere Sinneinheiten eingeteilt: europĂ€ischer Vergleich, strukturelle Aspekte (Bildung, Arbeitsmarkt), kulturelle bzw. mentale Aspekte sowie schlieĂlich ErklĂ€rungs- und (implizit auch) LösungsansĂ€tze.
weitere Rezensionen von Christoph Kramer

Im ersten Abschnitt zum europĂ€ischen Vergleich sticht der Beitrag von Gerda Neyer, Jan M. Hoem und Gunnar Andersson vom Max Planck Institut fĂŒr demografische Forschung heraus. Sie zeigen anhand der Situation in Schweden, daĂ die Bildungsrichtung fĂŒr Kinderlosigkeit entscheidender ist, als das Bildungsniveau. Zwar steigen die Kinderlosenanteile der schwedischen Frauen in allen Bildungsrichtungen mit dem Bildungsniveau an, aber in sehr unterschiedlichen GröĂenordnungen. So ist etwa in der Kohorte 1955-59 der Anteil kinderloser Ărztinnen, Sonderschullehrerinnen und ZahnĂ€rztinnen mit UniversitĂ€tsabschluĂ in etwa genauso hoch wie der Anteil kinderloser ReinigungskrĂ€fte, Textilarbeiterinnen und Postbeamtinnen, die nur die zweijĂ€hrige Sekundarstufe absolviert haben. AuffĂ€llig ist, daĂ besonders die im Unterrichtswesen und im Gesundheitswesen beschĂ€ftigten Frauen auf allen Qualifizierungsstufen eine deutlich niedrigere Kinderlosigkeit aufweisen als ihre Geschlechtsgenossinnen in anderen Branchen. Am höchsten sind die Kinderlosenanteile unter Geisteswissenschaftlerinnen (ohne Lehramtsqualifikation), Bibliothekarinnen und Theologinnen.
Der Beitrag von Katja Köppen (Max Planck Institut fĂŒr demografische Forschung), Magali Mazuy (UniversitĂ€t Paris) und Laurent Toulemon (Institut national dâĂ©tudes dĂ©mographiques Paris) befaĂt sich mit der Kinderlosigkeit in Frankreich, die eine der niedrigsten in ganz Westeuropa ist, obwohl auch hier ein Anstieg zu beobachten ist. ErklĂ€rt wird die französische Situation mit dem gut ausgebauten Netz der Kinderbetreuung sowie dem System staatlicher ZuschĂŒsse fĂŒr Familien. Das seit 1994 eingefĂŒhrte Erziehungsgeld fĂŒr das zweite Kind und die seit 2004 bestehenden monetĂ€ren Leitungen fĂŒr das erste Kind hĂ€tten allerdings die Konsequenz gehabt, Frauen zumindest kurzfristig aus dem Berufsleben auszugliedern. Diese Angebote wurden v.a. von jungen und unqualifizierten Frauen angenommen, die in Frankreich ĂŒberproportional hĂ€ufig von Arbeitslosigkeit betroffen sind.
JĂŒrgen Dobritz und Kerstin Ruschdeckel (beide Bundesinstitut fĂŒr Bevölkerungsforschung) stellen die einschlĂ€gigen Daten zu Kinderlosigkeit in Deutschland im europĂ€ischen Vergleich dar und kommen zu dem Ergebnis, daĂ es in Deutschland eine âbesondere Situationâ, vielleicht sogar einen âeuropĂ€ischen Sonderwegâ gibt. Nirgends sonst (auĂer in der Schweiz) gibt es so hohe Kinderlosenanteile und einen so starken Anstiegstrend wie in Westdeutschland. Die Daten der âPopulation Policy Acceptance Studyâ zeigen zudem, daĂ Kinderlosigkeit in Deutschland hĂ€ufiger als in anderen LĂ€ndern ein bewuĂtes und gewolltes Lebenskonzept darstellt. Auch wenn die Daten nicht ganz eindeutig sind, zeigen sie doch einen ĂŒbereinstimmenden Trend. ErklĂ€rt wird dieser Trend mit der familienpolitischen Situation in Westdeutschland, welche die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erschwert, wĂ€hrend relativ viel Geld in Ehe und Familie flieĂt. So konnte es zu einer Polarisierung zwischen kinderlosen berufstĂ€tigen Frauen und FamilienmĂŒttern kommen, wobei der Trend zur Entscheidung fĂŒr ErwerbstĂ€tigkeit und gegen Kinder geht. In Ostdeutschland habe die pronatalistische Politik und der antiindividualistische Kollektivismus einer geschlossenen sozialistischen Gesellschaft dagegen die Tradition der Familienbildung aus den 60er Jahren indirekt bewahrt. Hier blieb es statt der westdeutschen Polarisierung bei einer starken gesamtgesellschaftlichen Orientierung auf die Zwei-Kind-Familie. Die Kinderlosenanteile scheinen sich allerdings in den jĂŒngeren JahrgĂ€ngen denen Westdeutschlands anzugleichen. Bei der durchschnittlichen Kinderzahl pro gebĂ€rende Frau liegt Ostdeutschland allerdings zusammen mit Westdeutschland (fĂŒr den Jahrgang 1965) auf den beiden letzten PlĂ€tzen in Europa.
Im zweiten gröĂeren Abschnitt des Sammelbandes zur âSozialstruktur von Kinderlosigkeit in Ost- und Westdeutschlandâ widmet sich Hildegard Schaeper (Hochschulinformationssystem Hannover) der Kinderlosigkeit von Hochschulabsolventinnen verschiedener Examenskohorten (1989, 1993, 1997 und 2003) im Ost-West-Vergleich. In beiden Landesteilen zeigt sich im Zeitverlauf ein zunehmender Trend zum Aufschub der FamiliengrĂŒndung nach dem HochschulabschluĂ. Allerdings realisieren die Absolventinnen von ostdeutschen Hochschulen die Erstgeburt trotz Angleichungstendenzen immer noch signifikant schneller und hĂ€ufiger als ihre westdeutschen Pendants, was Schaeper auf eine âPersistenz der ostdeutschen Geschlechterkulturâ zurĂŒckfĂŒhrt.
Heike Wirth (Zentrum fĂŒr Umfragen, Methoden und Analysen Mannheim) untersucht die Kinderlosigkeit von Hochqualifizierten âim Paarkontextâ und kommt zu dem Ergebnis, daĂ sich die reduzierte Neigung zur FamiliengrĂŒndung bei Hochqualifizierten im Kohortenvergleich verstĂ€rkt. Unterschiede gibt es dabei zwischen hypergamen (Mann höher qualifiziert als die Frau), homogamen (gleichhohe Qualifizierung) und hypogamen (Frau höher qualifiziert als der Mann) Paaren. Am geringsten ist Kinderlosigkeit bei hypergamen und am stĂ€rksten bei hypogamen Paaren ausgeprĂ€gt. Der Anteil hypogamer Beziehungen ist immerhin schon auf 30 Prozent angestiegen. Daneben sind vor allem der steigende Anteil nichtehelicher Lebensgemeinschaften und die verstĂ€rkte Erwerbsbeteiligung der Frauen Faktoren, die mit der zunehmenden Kinderlosigkeit von Hochschulabsolventinnen korrelieren.
Besonders hervorzuheben ist der Artikel von Michael Stegmann und Tatjana Mika (beide Forschungsdatenzentrum der Rentenversicherung). Sie untersuchen die ZusammenhĂ€nge von Elternschaft und Alterseinkommen fĂŒr die JahrgĂ€nge 1928 bis 1955 im Ost-West-Vergleich. Die zugrundeliegenden Daten (Scientific Use File âRentenbestand 2003â und die Studie âAltersvorsorge in Deutschland 1996â) sind Ă€uĂerst reprĂ€sentativ, da der Anteil der Bevölkerung, der eine GRV-Rente erhĂ€lt, in Ostdeutschland 99 Prozent, in Westdeutschland etwa 90 Prozent ausmacht. Aus den Daten zum Rentenbestand 2003 lĂ€Ăt sich fĂŒr die JahrgĂ€nge 1928 bis 1938 ersehen, daĂ der GeburtenrĂŒckgang in Ost- und Westdeutschland eindeutig nicht auf Kinderlosigkeit zurĂŒckzufĂŒhren ist (im Gegenteil ist Kinderlosigkeit in diesen Kohorten sogar geringer geworden), sondern ganz entscheidend auf den RĂŒckgang der Familien mit vier und mehr Kindern. In Ostdeutschland ging der Anteil der groĂen Familien allerdings langsamer zurĂŒck. In beiden Landesteilen gehen die Gesamtdauer der ErwerbstĂ€tigkeit und die relative Einkommensposition der Frauen mit steigender Kinderzahl zurĂŒck. Im Westen verringerte sich stĂ€rker die Gesamterwerbsdauer, im Osten dagegen sank eher die Einkommensposition der Frauen mit zunehmender Kinderzahl. Beides fĂŒhrt zu geringeren Anwartschaften auf Renten. FĂŒr die ostdeutschen Frauen hat sich die Situation allerdings durch die 1992 beschlossene âAufwertung der Rente fĂŒr Geringverdienerinnen fĂŒr Zeiten vor 1992â deutlich gebessert. Dies und die Anerkennung der Kindererziehung in der Rente fĂŒhren fĂŒr ostdeutsche Frauen also zu einer teilweisen Kompensation der âEinkommensdiskriminierung von MĂŒtternâ in der Rente. In Westdeutschland, wo nicht der geringe Lohn, sondern die langen Ausfallzeiten das Problem darstellen, hĂ€ngt die Altersvorsorge der MĂŒtter meist am Einkommen des Ehemannes. Durch Kinder haben sich westdeutsche Paare und erst recht allein stehende Frauen im Vergleich zu ihren kinderlosen MitbĂŒrgern deutlich schlechter gestellt, und zwar je mehr Kinder, desto schlechter. Wie groĂ die Unterschiede tatsĂ€chlich sind, wird im einzelnen mit erschreckenden Zahlen belegt. DaĂ kinderlose Frauen und Paare auĂerdem stĂ€rker in der Lage waren, gröĂere finanzielle (an Kindern gesparte) Mittel in zusĂ€tzliche Altersvorsorge zu investieren, macht die Gesamtsituation noch ungerechter. Hier wird die Transferausbeutung von Eltern in Deutschland (West) mit HĂ€nden greifbar. Diese materielle Umverteilungsstruktur von Eltern zu Kinderlosen liefert sicher stĂ€rkere Anhaltspunkte zur ErklĂ€rung von Kinderlosigkeit und RĂŒckgang der GroĂfamilie als viele rein mentalitĂ€tsbezogene Modelle.
Solche eher mentalitĂ€tsbezogenen Untersuchungen liefert der dritte Abschnitt des Sammelbandes zu âKinderwunsch und Familienorientierung von MĂ€nnern und Frauenâ. Besonders gelungen ist hier der Beitrag von Mandy Boehnke (UniversitĂ€t Bremen), die die niedrigere Kinderlosigkeit bei ostdeutschen Hochschulabsolventinnen auf einen höheren âstrukturellen Defamilialismusâ (d.h. v.a. bessere Kinderbetreuungsangebote) bei gleichzeitig höherem âkulturellem Familialismusâ (ausgeprĂ€gte Familienwerte) in der ehemaligen DDR zurĂŒckfĂŒhrt, wĂ€hrend die Situation in der Bundesrepublik genau andersherum gewesen sei.
Jan H. Marbach und Angelika Tölke vom Deutschen Jugendinstitut MĂŒnchen liefern einen Beitrag zur Herausbildung eines neuen, von der traditionellen FamilienernĂ€hrerrolle abgesetzten alternativen MĂ€nnlichkeits- und VaterverstĂ€ndnisses, das u.a. die Bereitschaft beinhaltet, Erwerbsarbeitszeit einzuschrĂ€nken und sich mehr um die Familie zu kĂŒmmern. âTrendsetterâ fĂŒr dieses neuere Lebensmodell wĂ€ren bisher vor allem hoch gebildete, beruflich erfolgreiche jĂŒngere MĂ€nner, die in einer groĂstĂ€dtischen Umgebung leben und in Deutschland geboren wurden.
Jan Eckhard und Thomas Klein von der Soziologie der UniversitĂ€t Heidelberg beschĂ€ftigen sich mit der bei MĂ€nnern und Frauen unterschiedlichen Motivation zur Elternschaft. WĂ€hrend bei MĂ€nnern die Motive der âPaarbindungsfunktionâ und der âSicherungsfunktionâ von Kindern stĂ€rker ausgeprĂ€gt sei, wĂ€ren fĂŒr Frauen stĂ€rker âimmaterielleâ BeweggrĂŒnde von Bedeutung.
Laura Bernardi und Sylvia Keim von der âunabhĂ€ngigen Nachwuchsgruppe ,The Culture of Reproductionâ am Max Planck Institut fĂŒr demografische Forschung behandeln am Beispiel von vier Frauen (zwei aus Rostock und zwei aus LĂŒbeck) die âLebenswege und Familienmodelle berufstĂ€tiger Frauen aus Ost- und Westdeutschlandâ.
Im vierten und letzten Abschnitt des Sammelbandes geht es schlieĂlich um ĂŒbergreifende ErklĂ€rungsmodelle fĂŒr die hohe Kinderlosigkeit in Deutschland. Den Auftakt bestreitet Heike Kahlert vom Institut fĂŒr Soziologie und Demographie der UniversitĂ€t Rostock mit einem feministischen Ansatz. Der Wandel in den GeschlechterverhĂ€ltnissen hin zu Gleichberechtigung von Mann und Frau sei âhalbiertâ, weil âGender Mainstreamingâ bisher nur im öffentlichen Bereich stattgefunden habe. Der private Bereich sei dagegen weiterhin âweiblich codiertâ und nicht durch gleichberechtigte und geschlechtergerechte Arbeitsteilung gekennzeichnet. Kahlert fordert konsequenterweise eine âDemokratisierung der Familieâ und eine Umstrukturierung der geschlechtlichen Arbeitsteilung im privaten Raum. Die Politik solle die Haus- und Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern gerecht (d.h. gleich) verteilen. Wie so etwas konkret aussehen könnte, wird offengelassen. Dem Rezensenten schossen beim Lesen allerdings spontan einige unangenehme Visionen durch den Kopf, vom amtlich entsendeten âFamilienbeamtenâ, der die gerecht aufgeteilte Zeit beim Abwaschen und WĂ€schebĂŒgeln stoppt bis hin zum Familienumerziehungslager, in welches renitent patriarchalische Familien zur Besserung geschickt werden könnten.
Torsten Schröder von der UniversitĂ€t Bremen liefert ein âlebensverlaufstheoretisches Modellâ, das sich primĂ€r gegen die Vorstellung einer konsequent âgeplantenâ Kinderlosigkeit richtet. Kinderlosigkeit sei vielmehr das Resultat eines immer wiederkehrenden âflexiblenâ Aufschiebens von KinderwĂŒnschen bis es biologisch zu spĂ€t ist.
Der AbschluĂbeitrag in diesem Abschnitt stammt von dem LĂŒneburger Soziologen GĂŒnter Burkart. Er konstatiert eine âKultur der Kinderlosigkeitâ, die sich inzwischen in Deutschland verfestigt habe. D.h. Kinderlosigkeit wĂŒrde nicht mehr als Manko, sondern als kultureller Wert, tw. sogar als neues Ideal betrachtet. Eine individualistische âKultur der Selbstreflexion und Selbstthematisierungâ wĂŒrde sich in Bezug auf Elternschaft als eine âKultur des Zweifelsâ darstellen. Burkart wagt es in diesem Zusammenhang sogar, sich vom sonst dominierenden Vereinbarkeits-Mantra zu lösen und eine Professionalisierung der Elternschaft als Problemlösung anzudenken â natĂŒrlich nicht ohne die damit verbundenen âethischen Turbulenzenâ zu thematisieren. Zuletzt bringt er die âKultur des Zweifelsâ mit den sozialen Aufsteigern der Bildungsexpansion, der âGeneration der Achtundsechzigerâ, in Verbindung und Ă€uĂert eine vage Hoffnung hinsichtlich der jĂŒngeren Generation, bei der sich die Zweifel in Bezug auf Elternschaft möglicherweise wieder reduzieren könnten.
Fazit: Der Band ist ein sehr guter Einstieg in die derzeit gĂ€ngigen wissenschaftlichen Zugangsmöglichkeiten zum Thema Kinderlosigkeit. Viele BeitrĂ€ge arbeiten mit detaillierten Tabellen und instruktiven Graphiken. Hervorzuheben ist besonders die kritische Reflektion der verfĂŒgbaren statistischen Daten. Rundum gelungen.
geschrieben am 04.12.2007 | 1780 Wörter | 12860 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen