Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
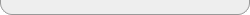
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Wilhelm II. Die Herrschaft des letzten Deutschen Kaisers
| ISBN | 3421043582 | |
| Autor | Christopher Clark | |
| Verlag | DVA | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 414 | |
| Erscheinungsjahr | 2008 | |
| Extras | - |

Rezension von
Max Bloch
An der Person Wilhelms II., des letzten Deutschen Kaisers, scheiden sich bis heute die Geister, und verschiedene Historiker sind emsig bestrebt, den Nachweis zu führen, dass seine politischen Einmischungen und Auslassungen den Weg zum Ersten Weltkrieg geebnet hätten, ja dass er sogar als eine Art „Bindeglied“ zwischen Bismarck und Hitler (John Röhl) einzustufen sei. Wie bereits in seiner großen Preußen-Geschichte, deren deutsche Übersetzung 2007 erschienen ist, ist es auch hier der neuseeländische (und in Cambridge lehrende) Christopher Clark, der sich – als Spezialist für das Gebiet der preußisch-deutschen Geschichte – den Blick von außen bewahrt hat und der den häufig von Leidenschaft diktierten Wertungen deutscher (oder deutsch-englischer) Historiker mit analytischer Kühle begegnet. Dabei ist es ihm nicht um die „Rehabilitierung“ des Kaisers zu tun, sondern um die nüchterne Feststellung der Fakten.
weitere Rezensionen von Max Bloch

In seiner lebendig geschriebenen, bündig formulierten Studie zeichnet er den Kaiser als einen von unbändigem Geltungsdrang, ja Prestigesucht getriebenen Menschen, dem es aber an nichts so sehr wie an der Fähigkeit gemangelt hätte, „ein eigenes konzises politisches Programm zu entwickeln oder durchzuhalten“. Oft schien der Kaiser augenblicklichen Eingebungen (oder Einflüsterungen unberufener Ratgeber, der sogenannten „Kamarilla“) allzu bereitwillig zu folgen, die er aber selbst schon kurz danach zu konterkarieren oder zu verwerfen verstand, sobald wirkliche Konflikte in Aussicht traten. Das allzu großspurige Gerede von einem „persönlichen Regiment“ und gottbegnadeter Herrschaft: „Einer nur ist Herr im Reiche, und der bin ich“, kontrastierte nur allzu schroff mit den tatsächlichen institutionellen Zwängen, denen er unterworfen war und denen er sich, konfliktscheu bis zur Ängstlichkeit, mehr als einmal fügte. Auf die Rücktrittsdrohungen seiner Kanzler Caprivi, Bülow und Bethmann Hollweg reagierte er jeweils mit nachgerade flehentlichen Bitten, ihn nicht zu verlassen, und räumte bereitwillig die vorher gehaltenen Bastionen seines kaiserlichen Willens. Bei der Besetzung der Staatssekretariate vermochte er seine Kandidaten nur in den seltensten Fällen durchzusetzen, kaiserliche Initiativen scheiterten regelmäßig am Widerstand der jeweiligen Ressortleiter, und Wilhelms fast vollständige Entmachtung während des Ersten Weltkrieges durch das „Zwillingspaar“ Hindenburg und Ludendorff kam in dieser Beleuchtung nicht von ungefähr.
Wie auf innenpolitischem, so verhielt es sich auch auf außenpolitischem Gebiet, wo er als „eine Art unkündbarer Einzelkämpfer“ die politische Reichsleitung quasi permanent in Atem hielt, bevor Reichskanzler von Bülow im Zuge der Daily-Telegraph-Affäre 1908 dem Kaiser öffentlich Zurückhaltung in politischen Fragen abverlangte und damit einem gravierenden Ansehensverlust der kaiserlichen Autorität – willentlich oder gezwungenermaßen – Vorschub leistete. Auch hier waren eher situative Eingebungen, Sympathien und Antipathien, ausschlaggebend als wirkliche strategische Überlegungen, die über den Tag hinaus Bestand gehabt hätten: Kaum dass er Ende der 1890er Jahre den Widerstandskampf der Buren gegen die britische Kolonialherrschaft mit leidenschaftlicher Anteilnahme verfolgt hatte, war er nach einer persönlichen Begegnung mit Cecil Rhodes für diesen derart eingenommen, dass er die brutale Unterwerfungspolitik der britischen Truppen in Südafrika – entgegen der öffentlichen Meinung in Deutschland – für die Blüte der Staatskunst hielt. Ebenso unentschieden agierte er während der Balkankriege 1912/13, als er zwischen den Beistandspflichten für das assoziierte Osmanische Reich und seinen Sympathien für die siegreichen Serben hin- und herschwankte. Zwischen seiner Selbststilisierung als „Friedenskaiser“, der in der Schaffung eines internationalen Ausgleiches vornehmste Fürstenpflicht entdeckte, und seinen oft bramarbasierenden Reden und gefürchteten Randnotizen herrschte eine gewisse Spannung, und doch war es gerade diese sentimentale Friedenssehnsucht, die Beobachtern in seinem Umfeld auffiel und die Anhänger des Präventivkriegsgedankens, wie den ebenfalls zur Nervosität neigenden General von Moltke, in Depressionen trieb. Diese oft ziellose Energie, die den Zeitgenossen nicht verborgen blieb, trug sicherlich zur Wahrnehmung Deutschlands als des unruhigen Nachbarn im Herzen Europas bei, war – wie Clark nachdrücklich betont – aber kaum dazu angetan, „den Kurs der auswärtigen Beziehungen zu gestalten“. Denn diese hingen nun doch von anderem ab als von den Sympathiewerten der jeweiligen Regenten.
Gleichwohl warnt Clark ebenso wie vor einer bombastischen Überhöhung auch vor einer Unterschätzung des kaiserlichen Einflusses. So bleibt hervorzuheben (wie Clark es tut), dass der Verzicht auf den unbeschränkten U-Boot-Krieg ohne die unbedingte Unterstützung des Kaisers (gegen Reichstag und öffentliche Meinung) wohl kaum bis 1917 durchzuhalten gewesen wäre. Auch Reichskanzler von Bethmann Hollweg und Generalstabschef von Falkenhayn wurden gegen die Treibereien Hindenburgs und Ludendorffs – trotz größten Drucks – bis 1916 bzw. 1917 gehalten. Wo der Kaiser stark blieb und Konflikte nicht scheute, konnte er – im Rahmen seiner verfassungsrechtlichen Befugnisse – tatsächlichen Einfluss entfalten, begab sich dieser Möglichkeiten aber allzu oft durch sein unberechenbares Naturell. Politisches Genie war ihm sicherlich nicht in die Wiege gelegt, und an Stetigkeit, Berechenbarkeit und Mut hat er es sträflich fehlen lassen. Ein „Kriegshetzer“, so das Fazit, war er, der sich im Juli 1914 als Schlichter angeboten und den habsburgischen Verbündeten von kriegerischen Aktionen in letzter Minute abzuhalten versucht hatte, jedoch beileibe nicht – so leicht man das Gegenteil durch einen selektiven Griff in den kaiserlichen Zitatenschatz auch zu belegen versuchen könnte. Christopher Clark wollte „Verunglimpfung und Verständnis wieder in ein angemessenes Verhältnis zueinander bringen“. Das jedenfalls ist ihm mit seinem auch Nichthistorikern verständlichen, immer ausgewogenen und in seinen Wertungen zurückhaltenden Porträt des letzten Deutschen Kaisers bravourös gelungen.
geschrieben am 18.11.2008 | 825 Wörter | 5333 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen