Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
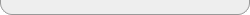
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
I have a dream. Die Kunst der freien Rede von Cicero bis Obama
| ISBN | 3406741894 | |
| Autor | Johan Schloemann | |
| Verlag | C.H.Beck | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 288 | |
| Erscheinungsjahr | 2019 | |
| Extras | - |

Rezension von
Dr. Sebastian Felz
Jedes Jahr im Dezember beschenkt der C. H. Beck Verlag seine Autorinnen und Autoren mit einem Buch. Während es im letzten Jahr Udo di Fabios beeindruckende Verfassungshistoriographie der Weimarer Reichsverfassung war, liegt dieses Jahr für die Autorinnen und Autoren des Münchener Verlages die Geschichte der Kunst der „freien Rede“ des Journalisten der Süddeutschen Zeitung, Johan Schloemann, auf dem Gabentisch. Von Cicero bis Obama wird die europäisch-nordamerikanische Entwicklung der „Stegreifrede“ nachgezeichnet. Diese personalisierte zeitliche Eingrenzung lässt Juristen aufhorchen, denn es handelt es sich bei den beiden Genannten nicht nur um herausragende Rhetoren und Politiker, sondern auch (vielleicht nicht zufällig) um zwei Juristen. Die Rechtswissenschaft ist eine Wortwissenschaft. Das Recht wird ausgelegt, kommentiert und gesetzt in schriftlichen Fassungen. Gleichzeitig wird „Recht gesprochen“. Schriftlichkeit und Mündlichkeit des Rechts stehen in einem Spannungsfeld, das auch bei Schloemann vermessen wird.
weitere Rezensionen von Dr. Sebastian Felz

Schon im Schwerpunktbereich (vgl. bspw. § 27 Abs. 1 der aktuellen Fassung der Prüfungsordnung für den Studiengang Rechtswissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster vom 7. Mai 2004), spätestens aber im Ersten sowie im Zweiten Juristischen Staatsexamen gilt Folgendes für den angehenden Juristen und die angehende Juristin in der mündlichen Prüfung (vgl. z. B. § 15 und § 55 JAG NRW):
„Durch den Vortrag soll der Prüfling zeigen, dass er befähigt ist, nach kurzer Vorbereitung in freier Rede den Inhalt einer Akte darzustellen sowie einen praktisch brauchbaren Vorschlag zu unterbreiten und zu begründen“ (Weisungen des Landesjustizprüfungsamtes NRW für den Aktenvortrag ab dem 22.02.2018).
„Rem tene, et verba sequentur“, wussten schon, so Schloemann, die alten Römer, „beherrsche die Sache, dann folgen auch die Worte“. Das gilt natürlich auch für den „in freier Rede“ vorgetragenen Aktenvortrag in den juristischen Staatsexamina. Hier sei ermutigend in Bezug auf diese nicht einfachen, aber gleichzeitig sehr wichtigen „Reden“ in der juristischen Ausbildung auf den auch von Schloemann behandelten Heinrich von Kleist und sein Prosastück „Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden“ verwiesen (vgl. auch Jens Petersen, Die mündliche Prüfung im ersten juristischen Staatsexamen, Berlin/Boston 2016, S. 11).
Die Einführung in den Sach- und Streitstand, das Plädoyer sowie die mündliche Darstellung einer Falllösung für Kollegen oder Mandanten sind nur einige Situationen, in der die „Kunst der freien Rede“ für Juristen von Bedeutung sein kann.
Schloemann beschreibt in der Einleitung sein Erkenntnisinteresse. Er will auf knapp 200 Seiten das Recht der „freie Rede“ als auch das Sprechen ohne Manuskript in über 2.500 Jahren europäischer Geistesgeschichte nachzeichnen. Die im Deutschen übliche Redewendung der „Stegreifrede“ hat ihren althochdeutschen Ursprung in der damaligen Bedeutung des „Stegreifs“ als „Steigbügel“. Derjenige, der frei und ohne Manuskript spricht, gleich demjenigen, der „ohne große Vorbereitung, ohne lange Überlegung, keck, gleichsam wie der fröhliche Reitersmann schnell noch etwas erledigt, ohne abzusteigen“, so die Definition aus dem Grimmschen Wörterbuch.
Schloemann beginnt – entgegen dem Untertitel seines Buches – seine Untersuchung schon im antiken Griechenland mit Homer, Sokrates, Platon, Aristoteles und Demosthenes. In der Zeit der griechischen Stadtdemokratie lagen alle wichtigen Entscheidungen in Recht und Politik bei der Mehrheit der (männlichen) Bürger. Mit der Partizipation aller wurden alle Entscheidungen in der Öffentlichkeit getroffen. Diese Öffentlichkeit wurde hergestellt durch öffentliche Reden und Debatten. Sei es in der politischen Versammlung auf dem Pnyx-Hügel in Athen oder vor den Volksgerichten. In letzteren saßen 201 oder noch mehr Richter, die ausgelost worden waren. Hier sprachen vor Laienjuristen erst der Ankläger, dann der Angeklagte bei laufender Wasseruhr, also limitierter Redezeit, in eigener Sache. Eine Vertretung durch einen Anwalt war nicht möglich. Die Überzeugung der Mehrheit der Zuhörer war also essentiell wichtig – im „Parlament“ wie auch vor „Gericht“. Um 430 v. Chr. entwickelten „Sophisten“ und „Logographen“ eine schriftgestützte Technik der Überzeugung, nämlich die Rhetorik. Bei Gerichtsprozessen war die Nachfrage besonders groß: Kläger, Ankläger, Beklagter und Angeklagter traten nicht freiwillig vor Gericht auf, und sie waren von der Entscheidung unmittelbar betroffen. Allerdings war im demokratischen Athen das Ablesen von einem Manuskript absolut verpönt. Dahinter stand die aus dem politischen Raum kommende Auffassung einer Gleichheits- und Unmittelbarkeitsfiktion. Verhandelt wurde, was alle anging, jeder sollte aufstehen und sich äußern können, allerdings aus dem Moment heraus und in Bezug auf den aktuellen Stand der Diskussion. Eine mitgebrachte Rede wäre ein Indiz für exklusives Spezialistenwissen gewesen, welches sich dem Zugriff der egalitären Diskussion der Vollversammlung der Bürger entziehe. Wer also keine „Stegreifrede“ halten wollte, der musste die vom Redenschreiber seiner Wahl verfasste Rede auswendig lernen. Die Schriftlichkeit, die sich immer mehr ausbreitete, fand schnell vehemente Kritiker. Platon kritisierte die Verschriftlichung des Wissens als Verhinderung in höhere Einsichten; der Sophist Alkidamas lehnte die Verschriftlichung ab, weil sie gegen die spontane Diskussion in der demokratischen Versammlung gerichtet war.
Die Rhetorik der Römer (Cicero, Quintilian u. a.) war im Gegensatz dazu durch Schriftlichkeit geprägt. Auch im Gerichtsprozess konnten sich die Parteien durch Anwälte vertreten lassen. Die frühe Kodifizierung des römischen Rechts sowie die Möglichkeit der Vertretung durch Anwälte führte zu einer Spezialisierung und Prozeduralisierung, welche nicht mit dem situativen Rechtswesen der Griechen vergleichbar ist. Die Rhetorik wurde zu einer schriftlichen Kunst. Auch wenn im Christentum die Opposition von „Buchstabe“ und „Geist“ durch den Apostel Paulus im Zweiten Brief an die Korinther gesetzt wurde, blieb und bleibt die christliche Predigt stark schriftgestützt. Die atlantischen Revolutionen zwischen 1770 und 1830 werden anhand der USA und Frankreich sowie (historisch natürlich weiter zurückführend) Englands in Bezug auf ihre Rhetorik untersucht. Schloemann weist zutreffend daraufhin, dass in allen drei Ländern die Geschworenengerichte zur demokratischen Verfasstheit dieser Staaten gehören. Der Rechtsbeistand muss eine Gruppe von Laienrichtern überzeugen. Darauf reagiert mit entsprechenden Lehrbüchern, Veranstaltungen und die studentischen Vereinigungen auch die Juristenausbildung. Deutschland als „verspätete Nation“ gelangte erst vor 100 Jahren zur vollständigen Demokratisierung und Parlamentarisierung. Die Geschäftsordnung des Weimarer Parlaments sah in § 45 Abs. 2 (genauso wie der Deutsche Bundestag in § 33 GO-BT) die freie Rede vor. Schon 1879 schrieben die „Reichsjustizgesetze“ die „freie Rede“ vor Gericht vor (§ 137 Abs 2 ZPO, § 261 StPO), damit war der vormoderne Aktenprozess Geschichte.
Schloemann gelingt es in fesselnder Weise, den Leser und die Leserin durch ĂĽber 2.000 Jahre Rhetorikgeschichte zu fĂĽhren, die auch eine politische und juristische Geschichte ist.
geschrieben am 22.01.2020 | 997 Wörter | 6522 Zeichen



Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen