Buchgenres
Stöbern Sie nach Büchern
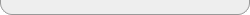
Google Anzeigen
Anzeigen
Bücher
Titan
| ISBN | 3453001589 | |
| Autor | Robert Harris | |
| Verlag | Heyne | |
| Sprache | deutsch | |
| Seiten | 541 | |
| Erscheinungsjahr | 2009 | |
| Extras | - |

Rezension von
Andrea Schütze
Mit einem furiosen Paukenschlag eröffnet Robert Harris den zweiten Teil seiner Cicero-Trilogie, die sich mit einem Zeitrahmen von Ciceros Konsulat und politischem Abstieg in die Verbannung chronologisch zwar an den ersten Teil anschließt, allerdings für das Verständnis das Lesen des ersten Teils nicht zwingend voraussetzt.
weitere Rezensionen von Andrea SchĂĽtze

Auftakt bildet ein schauerlicher Kriminalfall, den Robert Harris mit der ihm eigenen Kraft zu visualisieren als schauriges Omen beschwört. Die Leiche eines offenbar einem Ritualmord zum Opfer gefallenen, ausgeweideten (!) Jungen wurde im Hafen gefunden. Wie sich herausstellt, handelt es sich bei ihm um den Musik-Sklaven von Ciceros Konsulatskollegen Gaius Antonius Hybrida. Cicero, bereits zum Konsul gewählt, sein Amtsantritt steht unmittelbar bevor, wird an den Tatort gerufen. Tat und Schauplatz rufen Assoziationen einer antiken Version von Thomas Harris´ „The Silence of the Lambs / Das Schweigen der Lämmer“ wach. Cicero, einem Tatort-Kommissar ähnlicher als einem römischen Senator, wird von Harris in eine derart intensiv gezeichnete Szenerie verfrachtet, die das Zischen und Pfeifen der Blitzlichter einer herbeigerufenen Spurensicherung trotz historischer Unmöglichkeit nicht ungewöhnlich erscheinen ließe. Das ganze schauerliche Ereignis könnte ein negatives Omen darstellen. Als Leser ahnt man nichts Gutes, v.a. mit Blick auf die bewusst zur Schau gestellte Bestialität des noch im Verborgenen stehenden Täters. Wer die Geschichte von Ciceros Konsulat kennt, vermutet bereits an dieser Stelle, dass sich dahinter die Gestalt verbergen könnte, die von Cicero im Zuge seines Konsulats und seiner anschließenden Rechtfertigung am meisten dämonisiert wurde: Lucius Sergius Catilina.
Der erste Teil findet im Prinzip im historischen Rahmen der Catilinarischen Verschwörung statt, doch setzt Harris den Fokus nicht allein auf die Gestalt des von Cicero stilisierten oder realen Staatsfeindes Catilina, sondern eröffnet ein viel weiterreichenderes Geflecht. Catilina erscheint in diesem Machtpoker, der nach anderen Spielregeln als bisher abläuft, nicht als die treibende Kraft, wie es Cicero in seinen Reden vortrug und worin ihm Generationen von Historikern folgten, sondern als seinerseits im Spielfeld eingesetzte Spielfigur noch größerer Spieler, die man als Leser in Gestalten wie Pompeius, Crassus und dem in diese Liga aufsteigenden Caesar zu erahnen meint. Diese Zeitenwende markiert Harris sehr eindrucksvoll in dem Leichenzug, der pompa funebris des vom Schlaganfall dahingerafften Pontifex Maximus Metellus Pius (S. 102 f.). Harris illustriert in seiner sehr anschaulichen Schilderung der pompa nicht nur ein für die Nobilität dieser Zeit wesentliches Identifikations- und Abgrenzungsmomentum, sondern spricht zugleich den Abschied von der Macht einer bis dahin herrschenden, breiteren Gesellschaftsschicht zugunsten weniger Mächtiger an: „Es war, als wüssten wir alle, dass wir mit Pius […] Abschied von der alten Republik nahmen und nun etwas anderes in seinen Geburtswehen lag“ (S. 103). Die überraschend unerwartete Wahl Caesars zum Pontifex Maximus läutete diese Wende ein. Überhaupt nimmt Harris in diesem Teil nicht nur die Position des Geschichtenerzählers ein, sondern analysiert zugleich an vielen Stellen für den Leser sehr faszinierend die historischen bzw. politischen Zusammenhänge.
Die Skizzierung der Charaktere ist Harris teils sehr gut gelungen, wie etwa der frühe Protegé Ciceros, Rufus, der sich vom Parteigänger Ciceros zu dessen erbittertem Gegner wandelt (vgl. S. 48 f.), oder (besser als im Teil 1 der Trilogie) die Gestalt der Terentia, die ihrem scharfzüngigen und nicht immer so genialen Gatten zwar ordentlich „Zündung“ gibt („Kommt wahrscheinlich in Macedonia alles wieder rein“, S. 74), die sich aber andererseits zu einem echten und zuverlässigen Partner wandelt. Andere Gestalten hingegen erscheinen teilweise etwas zu überzeichnet, wie die zu einseitige und dämonisierende Charakterisierung Caesars (S. 35 f.), was allerdings gegenüber einer von Historikern (zu) oft gepflegten procaesarischen Haltung einen interessanten und wohltuenden Kontrapunkt setzt. Gleichfalls wurden die beinahe im Stil einer Jane Austen geratenen Gestalten der Nobiles mit ihren Ressentiments gegen den Aufsteiger und homo novus Cicero (S. 26) etwas zu deutlich karikiert. Auch Cicero selbst erscheint – wie schon in Teil 1 – sehr modern, manchmal fast zu modern im Typus eines Anwalts nach der Manier John Grishams. Andererseits setzt Harris in Ciceros Charakterisierung eine interessante Demaskierungstendenz fort, wie sie im erhaltenen Briefwechsel Ciceros jedem Leser entgegentritt, der zunächst nur Ciceros Reden und philosophischen Schriften kannte und nun vom anderen, von Selbstzweifeln und Unsicherheiten geplagten Menschen Cicero sehr überrascht wird. So lässt uns Tiro wissen, Cicero habe schlaflose Nächte zugebracht, habe im kreativen Chaos seines Büros an seinen Reden gefeilt und den Boden mit verworfenen Ansätzen übersät oder sich wegen zu großer Aufregung vor seinen öffentlichen Auftritten hinter den Kulissen auch bisweilen übergeben. Hier tritt dem Leser eine Persönlichkeit entgegen, die nicht den hehren Staatsmann und abgeklärten Philosophen vorstellt, den uns Cicero als vom ihm bewußt anvisierte Nachwelt gerne glauben zu machen suchte, sondern es ist ein zutiefst in seiner Menschlichkeit befangener Politiker, der in erster Linie jedoch ein Mensch bleibt.
Im Ganzen zeigt sich Harris gegenüber dem ersten Teil in seiner Darstellungskraft deutlich gereift. Seine szenischen Beschreibungen sind voll von Blicken, Gesten, bis hin zu Schnuten und herablaufendem Speichel als an den Leser herangetragene erzählerische Zooms, die den kontrollierten Handlung und kontrolliert gesprochenen Worten dieser Elite das psychologisch entlarvendere Momentum unkontrollierter Indizien für das wahrhaft Dahinterstehende einer Gesellschaft entgegensetzt, die – wie Harris gleich mehrfach herausstreicht – extrem intensiv auf kontrollierte Eigen- und Gruppendarstellung bedacht war.
Interessant ist auch das scheinbar Widersprüchliche einer von Omen bestimmten antiken Weltsicht, die zu glauben Cicero zwar ausdrücklich von sich weist (unterhaltsam in diesem Zusammenhang auch die Szene der vom Augur gefälschten Vorzeichen) deren Unwirksamkeit dem Leser in der abergläubischen Manier eines Sueton allerdings nicht zweifelsfrei erscheint, so etwa der Eingangs angeführte Ritualmord am Tag vor Ciceros Amtsantritt, ungewöhnlicher Schneefall (S. 23), eine Wolkenstimmungen mit Abendrot, die einem blutdurchtränkten Verband gleicht (S. 107), ein Zucken der Beine während des Ausweidens des noch nicht ganz toten Opferstieres (S. 61), eine einem Speer gleichende Sternschnuppe oder ein plötzliches Verdunkeln des Mondes als böse Omen (S. 75), das alle Teilnehmer dieses Erlebnisses in helle Aufregung versetzt. Sie alle lassen die folgenden historischen Entwicklungen aus der religiösen Warte eines Römers nicht anders als folgerichtig erscheinen. Harris spielt hier sehr schön auch mit dem heutigen Leser, für den er den paganen Vorzeichenglauben nicht entmystifiziert – im Gegenteil: „An die Zweige der Bäume und Büsche hatten die Einheimischen kleine Figuren und Masken aus Holz oder Wolle gehängt, die an die Zeit erinnerten, als noch Menschenopfer dargebracht und ein kleiner Junge erhängt wurde, um das Ende des Winters zu beschleunigen. Die bittere Kälte, die zunehmende Dämmerung, die unheimlichen, im Wind raschelnden Symbole – alles war von einer Schwermut durchdrungen, die ich kaum zu beschreiben vermag“ (S. 74).
Neben diese abergläubische Seite der Römer stellt Robert Harris eine auf Sensationen und derben Klatsch bedachte römische Welt vor, seien es die schmutzigen Zoten, die im Zusammenhang mit Caesars Wahl zum Pontifex Maximus über ihn und die Vestalischen Jungfrauen in Umlauf geraten, seien es die von Harris grandios geschilderten Rednerszenen, wie etwa einprägsame Tumulte in der Volksversammlung (S. 89 ff.), in der der Mob in gefährlichen Ausschreitungen außer Kontrolle zu geraten droht: „Die drei Männer schienen von dem Speichel zu glitzern, mit dem sie auf ihrem Weg zum Podium bespuckt worden waren“ (S. 90). Nicht weniger spektakulär inszeniert Harris die psychologische Demagogie Ciceros. Ein nicht anders als mutiges Unterfangen darf es genannt werden, dass Harris Cicero selbst reden lässt. Kein Redner dürfte in seiner Rhetorik besser analysiert worden sein als Cicero und Harris scheint sich hier zunächst auf dünnes Eis zu begeben, wenn er ihm nicht nur Worte, sondern eine ganze Rede in den Mund legt. Kann es Robert Harris wirklich mit einem Marcus Tullius Cicero aufnehmen? – Robert Harris dürften hier zwei wesentliche Gesichtspunkte hilfreich zur Seite stehen: Einmal erweist sich die Tatsache als äußerst hilfreich, dass die intensiven Rhetorik-Analysen nicht auf den live gehaltenen Reden Ciceros, sondern später veröffentlichten und sicherlich noch stark redigierten Publikationen des Redners beruhten. Weiter kommt Robert Harris nun sein klug gewählter Aufbau zur Hilfe, die Handlung in die Memoiren des alten Tiro einzukleiden, denn es spricht zu keinem Zeitpunkt der reale Cicero zum Leser, sondern man hört und sieht ihn nur durch die alten Augen Tiros, der aus der Erinnerung eines langen, fast hunderjährigen Lebens auf diese Ereignisse zurückblickt.
Robert Harris hat sich im zweiten Teil seiner Cicero-Trilogie nicht nur deutlich gesteigert, sondern ist über das Niveau des ersten Teils eindeutig hinausgewachsen. Während im ersten Teil noch viel Modernes antik überklebt erscheint, beginnt er im zweiten Teil vor dem Leser ein grandioses Sittengemälde zu entfalten, das nicht nur zweidimensional zum interessierten Betrachten einlädt, sondern den Leser dreidimensional in die römische Welt hineinzuziehen scheint und ihn nicht eher ruhen lässt, als bis er die letzte Seite dieses absolut empfehlenswerten Buches gelesen hat.
geschrieben am 05.01.2010 | 1406 Wörter | 8682 Zeichen
Rezension von
Sibylle Meister
Mit „Titan“, einer gelungenen Mischung aus Polit-Thriller und historischem Roman, legt der Bestsellerautor Robert Harris die Fortsetzung seines Erfolges „Imperium“ vor. Die als Trilogie angelegte Romanserie schildert das Leben und die Karriere des römischen Politiker Ciceros. Der deutsche Titel „Titan“ lässt an einen Cicero denken, wie man ihn aus dem Lateinunterricht kennt: den grossen Redner und Staatsmann. Doch Harris’ Cicero ist kein Titan, sondern ein Mensch mit Stärken und Schwächen. Treffender ist da der englische Titel „Lustrum“, der mit der Mehrdeutigkeit des lateinischen Begriffs spielt. Denn „Lustrum“ umschreibt das Sühneopfer der Zensoren für die kommenden fünf Jahre, kann aber auch „Morast“, „Lagerplatz der wilden Tiere“ oder „Bordell“ bedeuten – und jeder dieser Aspekte lässt sich gleichermassen im Buch wiederfinden.
weitere Rezensionen von Sibylle Meister

Der Roman schildert die Ereignisse der Jahre 63-58 v. Chr.: Cicero hat allen Anstrengungen seiner Feinde zum Trotz die Wahl zum Konsul gewonnen und steht nun an der Spitze des Staates. Doch schon die erste Szene lässt erahnen, dass seine Amtszeit nicht einfach sein wird: Die Leiche eines jungen Sklaven wird aus dem Tiber gezogen und alles deutet auf einen Ritualmord hin. Cicero glaubt zwar nicht an Omen und Vorzeichen, aber trotzdem wirft dieser Vorfall seinen Schatten auf die Zukunft, denn pikanterweise ist der Besitzer des Opfers Ciceros Amtskollege als Konsul. Schwerwiegendere Probleme kommen hinzu: Catilina, sein Rivale im Wahlkampf, kann seine Niederlage nicht vergessen. In seinem Umfeld sammeln sich Aristokraten, die auf den Emporkömmling Cicero herabblicken, korrupte Politiker sowie weitere dubiose Gestalten. Und im Hintergrund erscheint immer wieder eine Figur, die letztlich Ciceros Karriere entscheidet: C. Julius Caesar, der ein grösseres Spiel im Auge hat, als Cicero sich zunächst vorstellen kann. Der frischgebackene Konsul muss sich verschiedenen Fragen stellen: Wie weit wird Catilina, getrieben durch seine Rachsucht, gehen? Wie gross ist Ciceros Spielraum als Politiker wirklich? Und: sind illegale Methoden gerechtfertigt, wenn damit die Republik gerettet werden kann?
Erzählt wird die Geschichte aus der Sicht Tiros, Ciceros Haussklaven und Sekretärs. Als ständiger Begleiter seines Herrn ist er bei allen Ereignissen dabei, ohne selbst aktiv einzugreifen. Er schildert Cicero nicht nur als glänzenden Redner und klugen Politiker, sondern auch als Menschen, der gegen Unsicherheiten und Lampenfieber kämpft und aus Selbstüberschätzung grobfahrlässige Fehler begeht. Generell wirkt die Figurenzeichnung liebevoller und detaillierter als im ersten Teil der Trilogie. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Ciceros Familie. So entwickelt sich etwa Terentia von einer nörgelnden, auf Einfluss und Ansehen bedachten Ehefrau zu einer klugen Beraterin. Auch wird der Konflikt zu Ciceros Bruder Quintus gezeigt, der mit dessen Entscheidungen nicht immer einverstanden ist. Nur Tiro, der Erzähler, bleibt flach und wenig nachvollziehbar. Die schwächsten Szenen im Roman sind denn auch jene, in denen Tiro seine Rolle als Beobachter ablegt und selbstständig handelt. Ansonsten gelingt es Harris erneut, eine vergangene Welt lebendig werden zu lassen. Im gelungenen Wechselspiel zwischen Polit-Thriller und historischem Roman kommen neben den Intrigen auch die Alltagsszenen nicht zu kurz, die das Alte Rom plastisch hervortreten lassen. Bemerkenswert ist besonders, wie es Harris gelingt, sich strikt an den historischen Fakten zu orientieren und seinen Figuren dennoch Lebendigkeit und Charaktertiefe zu verleihen: Selbst wer aus dem Lateinunterricht noch weiss, wie die Geschichte ausgeht, kann das Buch kaum aus den Händen legen.
geschrieben am 08.07.2011 | 526 Wörter | 3231 Zeichen









Kommentare zur Rezension (0)
Platz für Anregungen und Ergänzungen